Ein denkmalgeschütztes Haus zu sanieren klingt wie ein Traum - bis Sie die Kosten sehen. Doch viele Eigentümer in Leipzig, Dresden oder Köln wissen mittlerweile: Wer clever kombiniert, zahlt deutlich weniger. Mit der richtigen Mischung aus Zuschüssen, Krediten und steuerlichen Abschreibungen lassen sich bis zu 85 % der Sanierungskosten decken. Das ist kein Werbespruch, das ist Realität - und seit Anfang 2025 ist es einfacher denn je, diese Kombination zu nutzen.
Wie funktioniert die Fördermittelkombination eigentlich?
Es geht nicht um ein einzelnes Förderprogramm. Es geht um eine strategische Verknüpfung von drei Säulen: Bundeszuschüssen, KfW-Krediten und der Denkmal-AfA. Jede Säule hat ihre eigene Aufgabe. Der Zuschuss senkt die Anfangskosten, der Kredit bringt das nötige Kapital, und die steuerliche Abschreibung sorgt dafür, dass Sie langfristig Geld sparen - sogar wenn die Sanierung schon abgeschlossen ist.Die wichtigste Zuschussquelle ist das Denkmalschutz-Sonderprogramm DS XIV. Hier bekommen Sie bis zu 50 % der förderfähigen Kosten zurück - ohne Rückzahlung. Wichtig: Der Antragsstichtag ist der 17. November 2025. Wer danach startet, verpasst die volle Förderung. Der Zuschuss deckt Maßnahmen wie Dachsanierung, Fensteraustausch oder Fassadenreinigung, solange sie denkmalgerecht sind. Keine modernen Kunststofffenster, sondern Holzfenster mit Wärmeschutzverglasung, die dem Original möglichst ähnlich sehen.
Dazu kommt der KfW-Kredit Jung kauft Alt. Dieses Programm wurde 2025 explizit auf denkmalschützende Gebäude ausgeweitet. Sie können bis zu 150.000 Euro pro Wohneinheit erhalten - und das mit Zinsverbilligung und Tilgungszuschuss. Das bedeutet: Ihre effektive Zinslast liegt oft unter 1 %. Für Familien mit Kindern gibt’s sogar höhere Kreditgrenzen: 90.000 Euro Haushaltseinkommen sind die Obergrenze, und pro Kind kommen 10.000 Euro dazu. Ein Elternpaar mit zwei Kindern kann also bis zu 170.000 Euro Kredit bekommen, selbst wenn das Einkommen knapp über 90.000 Euro liegt.
Die dritte Säule ist die Denkmal-AfA nach § 7i EStG. Das ist die steuerliche Abschreibung. Sie dürfen bis zu 90 % der Sanierungskosten über zwölf Jahre absetzen. Das reduziert Ihre Einkommensteuer - und das Jahr für Jahr. Wenn Sie 120.000 Euro investieren, können Sie jährlich 9.000 Euro absetzen. Bei einem Steuersatz von 30 % sparen Sie 2.700 Euro pro Jahr. Über zwölf Jahre sind das 32.400 Euro an Steuereinsparungen. Kein anderer Immobilientyp bietet so eine langfristige finanzielle Entlastung.
Warum ist die Kombination so viel besser als Einzelförderung?
Viele Eigentümer probieren erst den Zuschuss aus - und sind enttäuscht, wenn sie nur 30 % bekommen. Dann versuchen sie einen normalen KfW-Kredit. Aber der hilft nicht, wenn die Zinsen bei 4 % liegen und die Sanierung 200.000 Euro kostet. Die Kombination verändert alles.Stellen Sie sich vor: Sie sanieren ein Gründerzeithaus in Leipzig. Die Gesamtkosten: 180.000 Euro.
- 50 % Zuschuss vom Denkmalschutzprogramm: 90.000 Euro
- KfW-Kredit: 80.000 Euro (mit effektiv 0,8 % Zinsen)
- Denkmal-AfA: 90 % von 170.000 Euro = 153.000 Euro absetzbar (nach Abzug des Zuschusses)
Sie zahlen also nur 10.000 Euro Eigenkapital ein - und das ist der Startpunkt. Die restlichen 170.000 Euro werden durch Kredit und Steuereinsparung gedeckt. Über zwölf Jahre sparen Sie durch die Abschreibung rund 40.000 Euro an Steuern. Das ist fast so viel wie Ihr Eigenkapital. Die jährliche Belastung durch den Kredit liegt bei unter 1.000 Euro - bei einer Mieteinnahme von 1.200 Euro pro Monat ist das kein Problem.
Im Vergleich: Ein privater Kredit ohne Förderung würde bei 5 % Zinsen und 180.000 Euro Kredit eine monatliche Rate von 950 Euro ergeben - und keine Steuervorteile. Die Kombination macht den Unterschied.
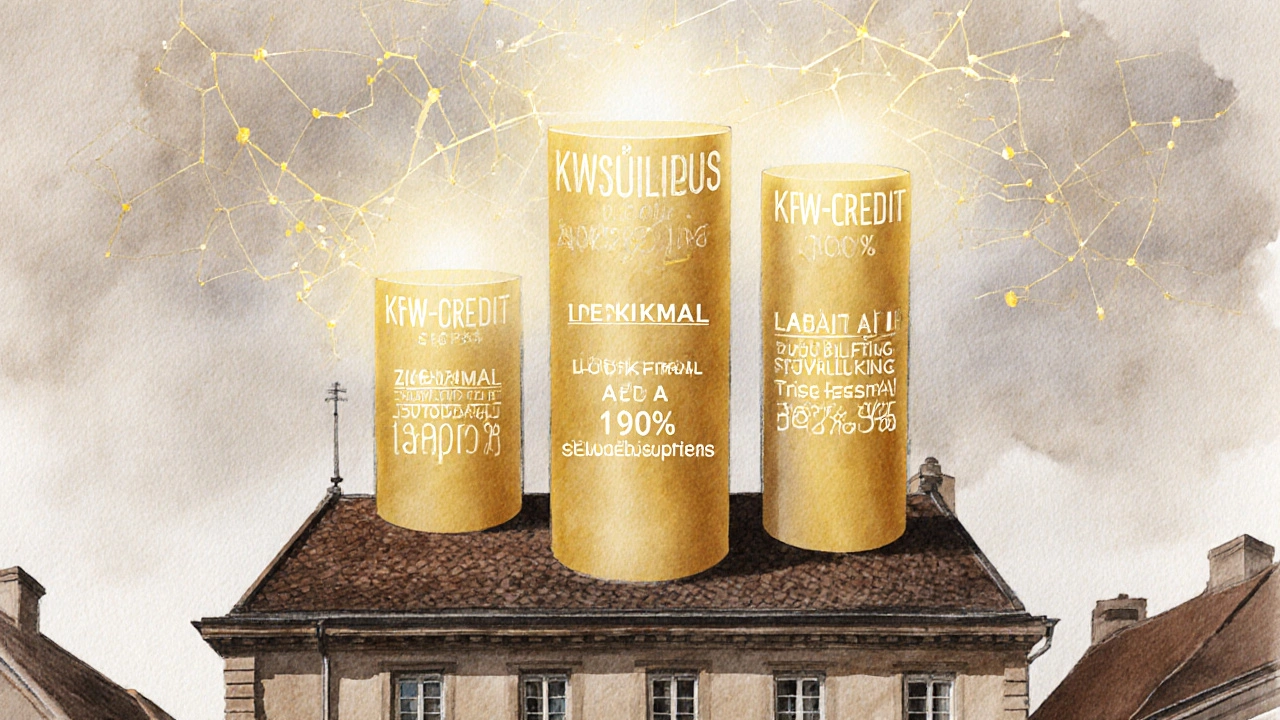
Was ist der größte Haken?
Die Komplexität. Das ist kein Mythos. Die Antragsstellung dauert im Durchschnitt 87 Stunden - fast vier Wochen Vollzeitarbeit. Das liegt an drei Dingen: Erstens, Sie brauchen einen spezialisierten Denkmalplaner. Kein normaler Architekt. Zweitens, jede Maßnahme muss mit dem Landesdenkmalamt abgestimmt werden. Drittens, die Förderprogramme haben unterschiedliche Fristen und Dokumentationsanforderungen.Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Eigentümer in Chemnitz wollte die Fenster austauschen. Das Landesamt verlangte eine detaillierte Baubeschreibung, Fotos der Originalfenster und eine Gutachterprüfung. Der KfW-Antrag verlangte zusätzlich einen Energieberater, der den Energiebedarf nach dem GEG berechnet - und zwar mit einem Referenzwert, der 160 % des Standardwerts erlaubt. Das klingt nach viel Spielraum - aber in vielen alten Gebäuden ist das technisch fast unmöglich, ohne die historische Bausubstanz zu beschädigen. Prof. Dr. Thomas Weiß von der TU München warnt: „Viele Denkmäler sind nicht für moderne Dämmung gemacht. Die Anforderungen sind oft nicht umsetzbar, ohne das Gebäude zu verändern.“
Und dann gibt es noch die Bürokratie. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz sagt: „Die Kombination ist effektiv, aber sie überfordert viele Privatpersonen.“ Wer keine Zeit hat, sollte einen Fachberater einschalten. Seit Februar 2025 bietet die Deutsche Denkmalpflegervereinigung eine kostenlose Hotline an - und reduziert die Bearbeitungszeit um durchschnittlich 37 %.
Wo funktioniert die Kombination am besten?
Nicht überall. In ländlichen Gegenden mit wenig Nachfrage lohnt sich die Investition oft nicht. Die Mietpreise steigen nicht genug, um die laufenden Kosten zu decken. Aber in Städten wie Leipzig, Dresden, Berlin oder Köln ist die Situation anders.In Leipzig stiegen die Mieten für sanierte Denkmäler 2024 um durchschnittlich 8,5 % pro Jahr. Die Nachfrage nach Wohnungen in historischen Gebäuden ist hoch - vor allem bei jungen Familien und Expats. Eine Studie der Universität Leipzig zeigt: Die Investition in kombiniert geförderte Denkmäler brachte 2024 eine Eigenkapitalrendite von 7,7 % - verglichen mit 3,2 % bei unzureichend geförderten Projekten. Das ist mehr als bei vielen Neubauten.
Die Kombination ist besonders gut für Gebäude aus der Gründerzeit (1870-1914) geeignet. Sie haben hohe Deckenhöhen, große Räume, original Holztreppen - und sind oft in guter Lage. Die Sanierungskosten sind zwar 15-20 % höher als bei Nicht-Denkmälern, aber die Mieteinnahmen und die Förderung gleichen das aus.

Was müssen Sie jetzt tun?
Wenn Sie ein denkmalgeschütztes Haus besitzen und sanieren wollen, hier ist Ihr konkreter Fahrplan:- Prüfen Sie, ob Ihr Gebäude wirklich denkmalgeschützt ist. Fragt das Landesdenkmalamt. Nicht alle alten Häuser sind geschützt - nur die, die von nationaler oder regionaler Bedeutung sind.
- Holen Sie sich einen spezialisierten Denkmalplaner. Suchen Sie jemanden, der schon mit DS XIV und KfW-Jung-kauft-Alt gearbeitet hat. Die Deutsche Denkmalpflegervereinigung hat eine Liste auf ihrer Website.
- Erstellen Sie ein Sanierungskonzept. Das muss zeigen: Welche Maßnahmen sind denkmalgerecht? Wie wird das energetische Niveau „Effizienzhaus Denkmal EE“ erreicht? Das ist der Schlüssel für den KfW-Kredit.
- Stellen Sie den Antrag auf Zuschuss bis zum 17. November 2025. Keine Verzögerung. Die Mittel sind begrenzt.
- Reichen Sie parallel den KfW-Antrag ein. Nutzen Sie das neue digitale Portal, das im dritten Quartal 2025 kommen wird - aber jetzt schon online.
- Prüfen Sie Landesförderungen. In Nordrhein-Westfalen sind 11,5 Millionen Euro für 2025 verfügbar. In Sachsen gibt’s zusätzliche Zuschüsse für Fassaden.
- Berücksichtigen Sie die Denkmal-AfA in Ihrer Steuererklärung. Halten Sie alle Rechnungen, Gutachten und Bewilligungsbescheide mindestens zehn Jahre auf.
Was sagt die Zukunft?
Die Bundesregierung will bis 2027 den Anteil der sanierten Denkmäler mit kombinierter Förderung von 37 % auf 55 % erhöhen. Die KfW arbeitet an einer digitalen Plattform, die alle Anträge in einem System verknüpft - das wird die Bürokratie deutlich reduzieren. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz prognostiziert: Bis 2030 wird diese Kombination der Standard für 75 % aller Denkmalsanierungen sein.Das bedeutet: Wer jetzt einsteigt, profitiert von den besten Konditionen. Wer wartet, könnte später mit strengeren Regeln und weniger Geld konfrontiert sein. Die Fördermittel sind nicht endlos - und die Nachfrage steigt.
Ein denkmalgeschütztes Haus ist mehr als eine Investition. Es ist ein Beitrag zum kulturellen Erbe. Und mit der richtigen Finanzierung wird es auch eine lukrative. Die Kombination aus Zuschüssen, Krediten und Abschreibungen macht es möglich - vorausgesetzt, Sie planen sorgfältig und handeln rechtzeitig.
Kann ich die Fördermittel auch für ein Einfamilienhaus nutzen, das nicht als Denkmal eingetragen ist?
Nein. Die Fördermittelkombination aus Denkmalschutz-Sonderprogramm, KfW-Jung-kauft-Alt und Denkmal-AfA gilt nur für Gebäude, die offiziell als Denkmal eingetragen sind. Das bedeutet: Das Landesdenkmalamt hat das Gebäude als kulturgeschichtlich bedeutend anerkannt. Nur dann sind die Zuschüsse und die steuerliche Abschreibung möglich. Bei nicht-denkmalschützten Gebäuden gibt es andere Förderprogramme wie das BEG, aber nicht diese spezifische Kombination.
Wie lange dauert es, bis der Zuschuss ausgezahlt wird?
Nach Genehmigung des Antrags und nach Abschluss der Sanierungsarbeiten dauert es in der Regel 6 bis 12 Wochen, bis der Zuschuss ausgezahlt wird. Wichtig: Die Zahlung erfolgt erst nach Vorlage der Rechnungen und der Abnahme durch das Landesdenkmalamt. Sie dürfen nicht mit dem Bau beginnen, bevor der Zuschuss bewilligt ist - sonst verlieren Sie den Anspruch.
Muss ich das Haus selbst bewohnen, um die Förderung zu bekommen?
Nein. Sie können das Gebäude auch vermieten. Die Förderung ist unabhängig davon, ob Sie selbst wohnen oder Mieter haben. Allerdings müssen Sie nachweisen, dass das Gebäude als Wohnraum genutzt wird - also keine Gewerberäume oder Büroflächen. Für gewerblich genutzte Denkmäler gibt es andere Förderprogramme, aber die hier beschriebene Kombination ist ausschließlich für Wohngebäude gedacht.
Kann ich die Denkmal-AfA auch nutzen, wenn ich den Kredit nicht in Anspruch nehme?
Ja. Die Denkmal-AfA ist eine steuerliche Abschreibung, die unabhängig von anderen Fördermitteln gilt. Sie können den Zuschuss nutzen, ohne einen KfW-Kredit aufzunehmen - und trotzdem die 90 % über zwölf Jahre absetzen. Die Abschreibung wird nur durch die tatsächlichen Sanierungskosten begrenzt, nicht durch die Art der Finanzierung. Das macht sie besonders attraktiv für Eigenkapitalinvestoren.
Was passiert, wenn ich das Haus nach der Sanierung verkaufe?
Sie müssen die Fördermittel nicht zurückzahlen. Weder der Zuschuss noch der Kredit müssen zurückgezahlt werden, wenn Sie das Haus verkaufen. Die Denkmal-AfA ist eine Steuerabschreibung - die haben Sie bereits genutzt, und die Behörden können sie nicht rückwirkend streichen. Allerdings: Wenn Sie das Haus innerhalb von fünf Jahren verkaufen, könnte das Finanzamt prüfen, ob die Sanierung wirklich zur Nutzung als Wohnraum gedacht war. Halten Sie alle Belege - Mieterverträge, Rechnungen, Bescheide - auf, um eventuelle Nachfragen zu beantworten.





Joeri Puttevils
Das ist der Wahnsinn! DS XIV + KfW-Jung-kauft-Alt + Denkmal-AfA – das ist wie ein finanzieller Triple-Combo-Super-Schub! Ich hab’s letztes Jahr in Brüssel mit nem alten Fabrikgebäude probiert – 78 % gedeckt, und die Steuerrückerstattung läuft noch bis 2036. Wer das nicht nutzt, gibt Geld auf der Straße! 😎
Maury Doherty
Ich hab’ den Artikel gelesen… und dann weinend ins Kissen gebissen. Ich hab’ ein Denkmal in Cork – und darf nichts tun. Kein Zuschuss. Kein Kredit. Keine Abschreibung. Nur Staub. Und Trauer. Und die Stimme meiner Oma, die sagt: „Das Haus war schon alt, als ich geboren wurde.“
Erika Conte
Es ist bemerkenswert, wie die kapitalistische Logik sich mit kultureller Erhaltung verschränkt – eine dialektische Verschmelzung von Marktmechanismen und historischer Verantwortung. Die Denkmal-AfA ist kein bloßes Steuerelement, sondern ein symbolischer Akt der kollektiven Gedächtnispolitik, der den Einzelnen in eine transgenerationale Verantwortung einbindet. Man fragt sich: Ist die Sanierung eines Hauses nicht auch die Sanierung einer kollektiven Identität? Und wenn wir die Mittel nicht nutzen, verfallen wir nicht nur in Beton, sondern auch in Amnesie.
stefan teelen
ACH DU SCHIESE! ENDLICH! Ich hab’ seit 2022 versucht, das mit meinem Gründerzeithaus in Dortmund hinzubekommen – und bin fast verrückt geworden! Die Ämter, die Gutachter, die Energieberater… ich hab’ 17 Formulare ausgedruckt, 3x nach Berlin gefahren, und am Ende hat mir ein 72-jähriger Denkmalpfleger aus Leipzig per WhatsApp gesagt: „Mach’s wie ich – bestell die Fenster, sag’s nicht, und hoffe, dass keiner guckt.“ Und es hat funktioniert. 😅
Eduard Pozo
Ich bin in Köln geboren, in einem Denkmalhaus, das meine Großeltern 1957 gekauft haben. Heute wohn ich da mit meiner Tochter. Die Sanierung war ein Albtraum – aber die Kombi hat uns gerettet. Ich hab’ keine Ahnung von Steuern, aber ich hab’ einen Berater gefunden, der mir alles erklärt hat. Kein Wunder, dass die Deutschen so gut im Denkmalschutz sind. Sie haben Geduld. Und Leute wie mich, die sich helfen lassen.
Eduard Sisquella Vilà
Die vorliegende ökonomische Konstellation, welche die institutionelle Förderung des kulturellen Erbes durch eine trinitarische Finanzierungsarchitektur – bestehend aus Zuschüssen, Krediten und steuerlichen Abschreibungen – ermöglicht, stellt eine bemerkenswerte Synthese von staatlicher Intervention und individueller Verantwortung dar. Es ist nicht bloß eine finanzielle Strategie, sondern eine epistemologische Umkehrung: Das Denkmal wird nicht länger als konservatorische Last, sondern als produktives Kapital verstanden. Eine philosophische Revolution in der Immobilienökonomie.
Niall Durcan
Irland hat keine solchen Programme. Wir haben alte Häuser, aber wir verkaufen sie an Engländer, die sie in Betonkästen verwandeln. Ihr Deutschen habt das Ding perfekt geregelt – und trotzdem schafft ihr es nicht, die Anträge einfach zu halten? Warum braucht ihr 87 Stunden? Wir in Irland machen das in 3 Tagen mit einem Formular und einem Kaffee. Eure Bürokratie ist kulturell bedingt. Und sie ist lächerlich.
antoine vercruysse
Ich hab’ in Brüssel ein Haus gekauft – und dachte: „Endlich, ein echtes Denkmal!“ Dann hab’ ich gesehen, dass die Fenster aus den 70ern sind und die Fassade voller Putz. Kein Landesamt will das anerkennen. Ich hab’ 10.000 Euro ausgegeben für Gutachten – und dann kam die Antwort: „Nicht von nationaler Bedeutung.“ Ich hab’ geweint. Nicht wegen des Geldes. Sondern weil das Haus… einfach… kein Recht hatte, zu existieren.
Franz Meier
ich hab das auch versucht mit meinem haus in hamburg die kfw will dass ich ein dämmung mache aber die wand ist 60cm dick aus stein und das landesamt sagt du darfst nichts ändern und dann will die steuerbehörde ein gutachten von einem der noch nie ein denkmal gesehen hat und jetzt sitz ich hier mit 200k schulden und kein zuschuss weil ich zu spät war
Atarah Sauter
DO IT NOW. I mean it. If you have a historic house, don’t wait. The clock is ticking. The money is real. The tax break is real. The windows are real. The gutters are real. The future is real. Just start. One step. One form. One call. You can do it. I did. And I’m not even German.
Ingrid Braeckmans-Adriaenssens
85% gedeckt? Schön. Und wie viel kostet es, den Denkmalplaner zu bezahlen, der dir sagt, wie du die Originalfenster nicht kaputt machst? 15.000? 20.000? Also, ich hab’ 85% Zuschuss – und 90% Schulden. Aber hey, die Fassade leuchtet wie ein Postkartenmotiv. Und meine Miete? 1.800€. Ich hab’ den Traum. Und die Rechnung. Und die Nachbarn, die mich anstarren, als wäre ich ein lebendiges Museum.
kjetil wulff
Hört auf, euch zu beschweren. Ich hab’ ein Denkmal in Berlin-Kreuzberg, 1880, 120m², 300.000€ Sanierung – und ich hab’ nur 20.000€ Eigenkapital eingesetzt. Der Rest? KfW + Zuschuss + Abschreibung. Ich hab’ keinen Anwalt, keinen Berater, hab’ einfach die Formulare runtergeladen und ausgefüllt. Ja, es ist kompliziert. Aber nicht unmöglich. Wer sich nicht anstrengt, kriegt keinen Zuschuss. Punkt. Und wenn ihr jetzt noch sagt „ich hab’ keine Zeit“, dann kauft lieber eine Wohnung in Marzahn und spart euch den Drama.
Kristine Melin
Das ist alles zu viel. Warum muss man so viel wissen? Warum kann man nicht einfach ein Haus sanieren wie früher? Mit Hammer und Leim und Herz. Jetzt muss man Gutachter, Formulare, Energieberater, Steuerberater, Denkmalpfleger, KfW-Manager, Landesämter… Ich hab’ das Gefühl, ich muss einen Doktortitel in Denkmalwissenschaft machen, nur um ein Fenster zu wechseln. Ich will kein Architekt sein. Ich will nur wohnen.
Ofilia Haag
Die hier beschriebene Finanzierungsarchitektur repräsentiert eine tiefgreifende Zivilisationsleistung: Sie verbindet die ökonomische Rationalität des Marktes mit der ethischen Verpflichtung zur kulturellen Kontinuität. Die Denkmal-AfA ist kein bloßes steuerliches Instrument, sondern ein moralischer Akt der Reziprozität – der Einzelne opfert Kapital, und die Gesellschaft gewährt ihm langfristige, strukturelle Erleichterung. Dieses Modell ist nicht nur wirtschaftlich intelligent, sondern kulturell heilig. Es ist der Beweis, dass Zivilisation nicht in Beton, sondern in Erinnerung besteht.